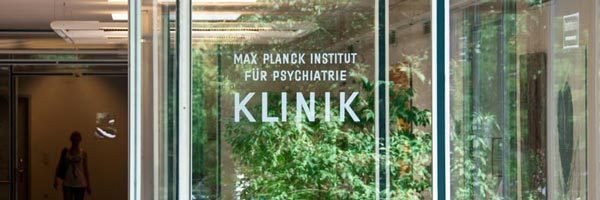Klinische Studien
In unseren klinischen Studien konzentrieren wir uns auf die biologischen Wirkmechanismen von Psychotherapie sowie auf die optimale Anpassung der psycho- und pharmakotherapeutischen Behandlung an die individuellen PatientInnen. Wir versuchen außerdem Biomarker zu identifizieren, die psychiatrische Diagnosen verbessern helfen. Die Proben und Daten, die wir von PatientInnen bekommen, verwalten und archivieren wir in unserer Biobank.
Einen Überblick über alle Studien, für die wir ProbandInnen suchen, erhalten Sie hier.
Wir untersuchen, welche biologischen Mechanismen beteiligt sind und wie sie eventuell zur Besserung von Symptomen führen.
Wir untersuchen, ob und welche objektiv erhobenen Messwerte wichtige Aussagen über psychische Störungen liefern können.
Wir möchten die wirksame und sichere Elektrokonvulsionstherapie noch genauer verstehen, um die Behandung zu verbessern.
Erforschung einer Biomarker-Kombination, die ein Ansprechen auf Lithium bei schwerer Depression vorhersagt
Abgeschlossene Studien
Wir untersuchen, wie Psychotherapie wirkt und welches Verfahren bei welchem Patienten am wirkungsvollsten ist.
mehr